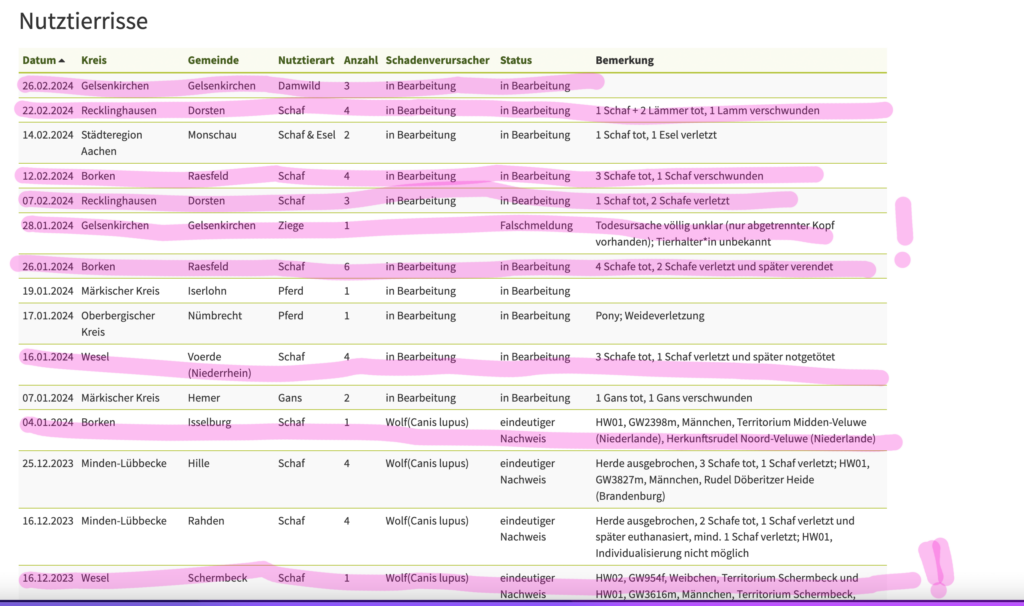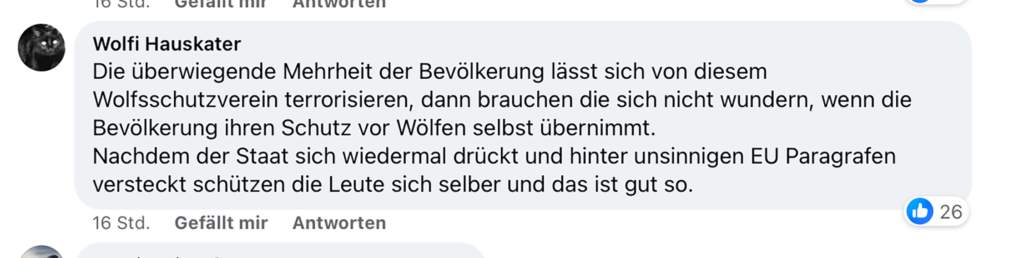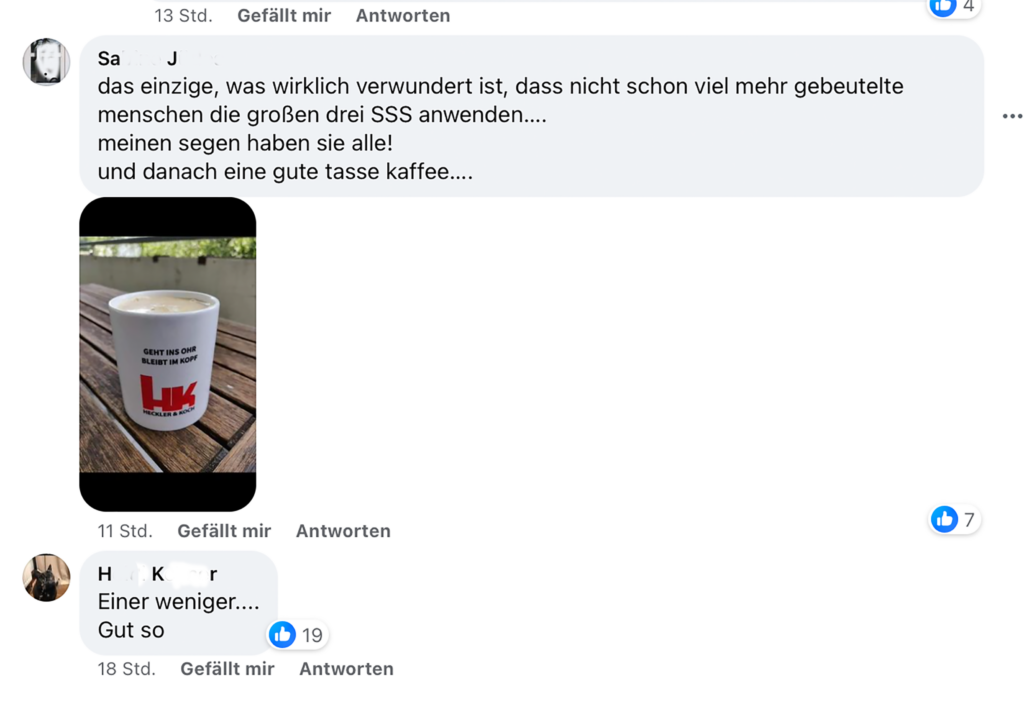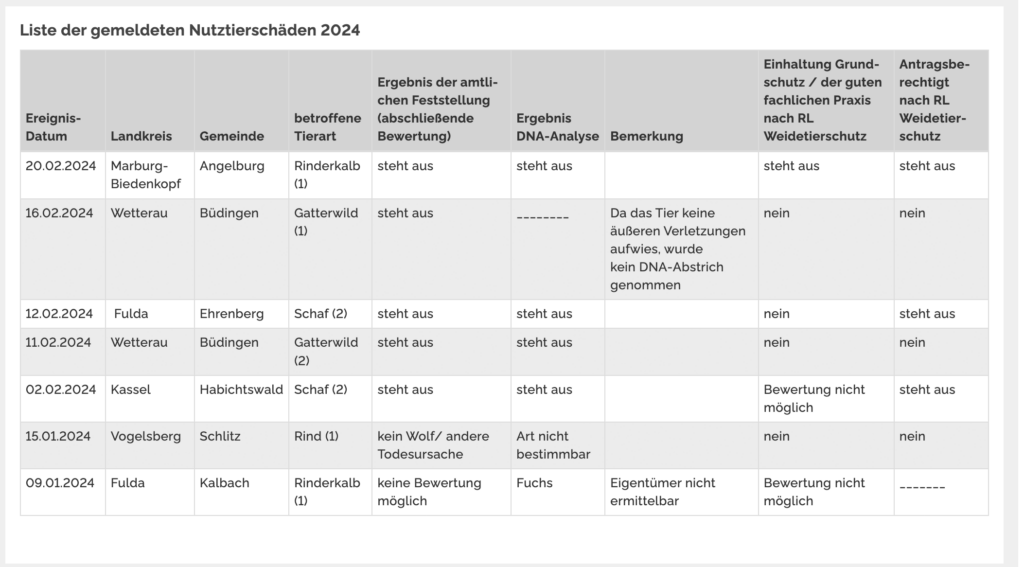Wir freuen uns über Unterstützung
Es ist leider Fakt, dass der Schutz der Wölfe in Zukunft wohl immer mehr über Gerichte und Anwälte durchgesetzt werden muss. Deshalb brauchen wir auch dringend finanzielle Unterstützung. Unser Verein wird nicht staatlich gefördert, was uns zum einen tatsächlich auch sehr unabhängig macht, zum anderen aber natürlich auch unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt.
Schon kleine, regelmäßige Beiträge, wie z. B. ein monatlicher Dauerauftrag von 5 Euro können uns helfen. Seit Vereinsgründung vor fünf Jahren standen wir ohne wenn und aber und politische Winkelzüge auf der Seite der Wölfe und wir widersprachen unerschrocken Politkern ebenso wie anderen Verbänden. Gerade in diesen schweren Zeiten ist ein Verein wie der unsere essentiell.
Wolfsschutz-Deutschland e.V.
Berliner Sparkasse
IBAN DE79 1005 0000 0190 7118 84
BIC BELADEBEXXX
Auch Paypal ist möglich: https://wolfsschutz-deutschland.de/spenden-2/
So könnt Ihr uns aktiv in den Wolfsgebieten helfen: